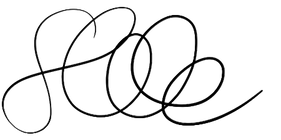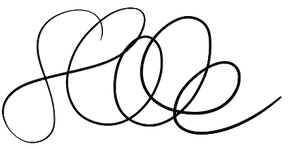attraktorale Atmosphären
Seine Arbeiten folgen dem von seinem Galeristen Carsten Lehmann geprägten Begriff der „attraktoralen Kunst“: Einzelne Farbfelder, Farbinseln, Linien oder Striche steuern wie Attraktoren, die Spannungsfelder erzeugen, welche den Raum erst hervorbringen. Der Bildraum entsteht nicht durch klassische Komposition, sondern durch das Beziehungsgeflecht der Elemente zueinander.
Damit erkennt Stehle eine philosophische Denkfigur von Kant, Sloterdijk, Heidegger und Jullien an – ebenso wie Zen-Ästhetik und asiatische Malerei. Kunsthistorisch steht sein Werk in der Linie von Caspar David Friedrich über Arte Povera und den Expressionismus bis hin zu Rothko und Twombly – jedoch ohne deren Pathos.
Stattdessen schafft er mit radikaler Reduktion eine Kunst der atmosphärischen Preise. Seine Bilder sind keine Aussagen, keine historischen Erfahrungen. Sie sprechen nicht über die Welt, mehr als letzten Raum verstehen. Raum als Begegnung. Und Begegnung als Kunst.
In seiner Welt entstehen Räume nicht durch Volumen, sondern durch Beziehung. Ein Punkt, eine Linie, eine Flamme – sie stehen nicht einfach auf der Leinwand. Sie machen das, was sie berechnen, zu einem Beziehungsraum. Und sie machen damit die Malerei zu einem Weg, der Raum stiftet, wo zuvor nur Fläche war. Die Frage ist auch nicht mehr, ob Kunst etwas darstellt, sondern was sie im Betrachter auslöst, in Bewegung setzt, öffnet. Stehles Bilderfunktionen wie Resonanzkörper für eine neue Kunst von Wahrnehmung – nicht objektiv, nicht psychologisch, mehr als menschlich. Nicht narrativ, sondern situativ. Nicht metaphorisch, sondern real.
 untitled, AV-P-Nr.040
untitled, AV-P-Nr.040
Das Unsichtbare sehen lernen. Die 10 Jahre, die Gregor Stehle in einem Zen-Kloster in Frankenreich verbrachte, sind keine biografische Fußnote, sondern Teil seines künstlerischen Denkens. Sie bilden das untergründige Prinzip seiner Malerei. Zen ist keine Religion, wohl eine Form des radikalen Sehens. Der Geist wird beruhigt, nicht um leer zu sein, sondern um aufnahmefähig zu werden. In der Zen-Ästhetik – etwa in der Kalligrafie oder dem Bogenschießen – ist das Ziel nicht die Perfektion, sondern die vollständige Präsenz im Moment des Tuns. Genau in dieser Haltung liegt der Ursprung von Stehles Arbeiten. Die Farbe, der Strich, der Fleck. Das Wirken der Dinge jenseits ihrer Form. Ihre Luzidität. (Jullien) Eine Malerei, die nicht spricht, aber nicht klingt, die nicht erkennt, aber anziehend ist.
Stehles Kunst ist kein Ausdruck eines zuvor geplanten Konzepts. Kunst versteht aus einem Zustand absoluter Klarheit, in dem nichts mehr gewollt wird. Die Geste ist nicht kontrollierbar, sondern wach. In der Praxis bedeutet das: Ein Bild beginnt für Stehle mit dem Aufstieg einer weißen Flamme – eine leere Leinwand, ein Papier, ein Grund. Dann folgt das Warten. Tage- oder wochenlang leben mit dieser präsenten Leere und entleert an ihr. Bis der Impulskommt. Nicht aus dem Willen, sondern aus dem Zustand. Dann – in wenigen Minuten – geschieht die Malerei. Ein Impuls, ein Akt, ein Satz. Und dann ist es vorbei. Diese Arbeitsweise erweitert das westliche Konzept der Kunstproduktion grundlegend. Sie ist nicht auf Dauer, nicht auf Korrektur, nicht auf Werkcharakter statt. Sie gleicht der japanischen Tuberkulose, bei der der erste Strich der einzig mögliche ist – unlieferbar. Was nicht gelingt, wird nicht verbessert. Es wird verworfen. Das Werk ist Spur. Oder, mit Roland Barthes gesprochen: ein „Punktum“, das nicht zeigt, sondern trifft.
 Kant, Sloterdijk, Popper, Heidegger, Jullien. In Stehles Werk werden philosophische Linien sichtbar, die seine Haltung zur Welt – und damit zur Kunst – prägen. Bei Kant ist Raum keine Eigenschaft der Welt, wohl aber eine Vorstellung der Anmeldung. Raum ist etwas, das erst im Subjekt entsteht. Stehle für diese Gedankenwege: Raum ist nicht nur eine Anschauungsform, sondern ein Erregungsfeld. Nicht nur das Subjekt konstituiert den Raum – auch die Dinge auf der Flamme tun es. Ein Strich kann Raum erzeugen. Eine Leerstelle kann ihn öffnen. Peter Sloterdijk denkt in seinen Sphärenbänden den Raum als Beziehungssphären – als Blase, als Nest, als Mitsein. Diese Vorgeschichte lässt sich direkt auf Stehles Arbeiten anwenden: Jedes Bild ist eine kleine Sphäre, ein Beobachtungsraum zwischen Elementen, Farben – aber auch zwischen Werk und Betrachter. Sloterdijks Griff der „Ko-Existenz“ wird bei Stehle zur Ko-Komposition. Karl Popper unterscheidet wieder zwischen der Welt der Dinge (Welt 1), die Welt der mentalen Züge (Welt 2) und die Welt der objektiven Inhalte (Welt 3). Stehles Werke oszillieren genau zwischen diesen Reichen: Sie sind physisch da, psychologisch wirksam, aber zugleich Träger von Bedeutung, ohne zu deuten. Sie bewohnten Welt 3 ohne Sprache. In seinem berühmten Vortrag „Der Ursprung des Kunstwerks“ (1935/36) spricht Martin Heidegger über den Raum, als etwas, das erst durch das Werk eröffnet wird. Das Kunstwerk schafft Raum,
Kant, Sloterdijk, Popper, Heidegger, Jullien. In Stehles Werk werden philosophische Linien sichtbar, die seine Haltung zur Welt – und damit zur Kunst – prägen. Bei Kant ist Raum keine Eigenschaft der Welt, wohl aber eine Vorstellung der Anmeldung. Raum ist etwas, das erst im Subjekt entsteht. Stehle für diese Gedankenwege: Raum ist nicht nur eine Anschauungsform, sondern ein Erregungsfeld. Nicht nur das Subjekt konstituiert den Raum – auch die Dinge auf der Flamme tun es. Ein Strich kann Raum erzeugen. Eine Leerstelle kann ihn öffnen. Peter Sloterdijk denkt in seinen Sphärenbänden den Raum als Beziehungssphären – als Blase, als Nest, als Mitsein. Diese Vorgeschichte lässt sich direkt auf Stehles Arbeiten anwenden: Jedes Bild ist eine kleine Sphäre, ein Beobachtungsraum zwischen Elementen, Farben – aber auch zwischen Werk und Betrachter. Sloterdijks Griff der „Ko-Existenz“ wird bei Stehle zur Ko-Komposition. Karl Popper unterscheidet wieder zwischen der Welt der Dinge (Welt 1), die Welt der mentalen Züge (Welt 2) und die Welt der objektiven Inhalte (Welt 3). Stehles Werke oszillieren genau zwischen diesen Reichen: Sie sind physisch da, psychologisch wirksam, aber zugleich Träger von Bedeutung, ohne zu deuten. Sie bewohnten Welt 3 ohne Sprache. In seinem berühmten Vortrag „Der Ursprung des Kunstwerks“ (1935/36) spricht Martin Heidegger über den Raum, als etwas, das erst durch das Werk eröffnet wird. Das Kunstwerk schafft Raum,
es räumt, im Sinne von Raum geben. In diesem Sinne räumt Stehle dem Raum ein. Er eröffnet durch sein Werk uns die Sicht in und auf den Raum. Das heideggerische Existenz des „in-der-Welt-sein“ wird bei Stehle zu einem im-Raum-sein weitergedacht. Und schließlich François Jullien, der französische Sinologe, der die chinesische Landschaftsmalerei als radikal anders beschrieb: Nicht der Blick erkennt das Bild, sondern das Bild den Blick. Nicht der Ausschnitt, sondern das Sich-Entfalten. Bei Stehle ist die Fläche nicht Fenster, sondern Horizont. Kein Bildausschnitt, sondern Raumprozess. Diese für Denker Strukturen nicht nur Stehles Denken. Sie sind – immanent – in jedem Bild präsent. Denn seine Bilder denken. Aber „sie tun es ohne Worte“ .
Von der Astrophysik zur Ontologie der Flammen. Der Begriff „Attraktor“
stammt aus der Chaostheorie. Ein Attraktor ist ein Zustand, auf den ein dynamisches System zusteuert, ohne dass dieser Zustand selbst stabil ist oder greifbar wäre. Stehle nimmt diesen Begriff auf, aber er transformiert ihn. In seinen Bildern wird der Attraktor zu einem Bildeignis: eine Flamme, ein Farbfeld, ein Kratzer, das andere Element auf sich beziehend, sie in Beziehung setzend. Nichts steht für sich. Alles wirkt aufeinander. Diese Logik ist nicht nur formaler Natur. Sie hat ontologische Tiefe. Denn sie verändert den Status des Bildes radikal:

untitled, AV-P-Nr.056
Die Malfläche ist kein neutralerTräger mehr, sondern ein Feld von Anziehung und Spannung. Weiße und Engung (Hermann Schmitz) Die Linie ruft die Flamme. Der Fleck aktiviert die Leere. Der Strich erzeugt Raum. Und dieser Raum ist keine Illusion, wohl eine Erfahrung. Diese Denkweise verbindet Stehle mit der phänomenologischen Tradition – vor allem mit Hermann Schmitz, der begriff der „Atmosphären“ nichts als psychologisches Gefühl, sondern als leiblich spürbare Realität versteht. In dieser Tradition ist ein Bild nicht ein Zeichen, sondern ein Reignisfeld. Es zieht den Körper in seiner Sphäre. Es erkennt eine Einstellung, die nicht im Bild liegt, als zwischen Bild und Betrachter. In der westlichen Kunstgeschichte ist dieses Denken sel-ten geworden. Zu stark ist die Prävention durch das Sichtbare, das Abbild, Kunstgeschichtliche Linien und Brüder.Gregor Stehle steht in einer paradoxen Tradition: Er ist ganz nachfahre und Dissident der europäischen Malergeschichte. Seine Kunst lässt sich nicht einorden, aber rückblickend verorten: Er ist der deutsche Romantische Verbunden – ins Besondere Caspar David Friedrich. Nicht weil er Landschaftsmann, sondern weil er das Unsichtbare im Sichtbaren bringt. Wie Friedrich denkt Stehle Malerei nicht als Darstellung, sondern als Kontemplation. Er ist ein Schüler der chinesischen Malerei, in der Leere ist auch aktiv wie die Form, das Volle. In der das Weiße nicht Hintergrund, Sonder Atem ist.

untitled, AV-P-Nr.056
In der das Sehen selbst zur Übung wird. Er ist durch- gefahren von der Art Brut – in der der Ausdruck nicht ausgearbeitet, sondern roh ist. In der das Material nicht veredelt wird, sondern Widerstand bleibt. In der der Strich eine Spur ist, keine Geste. Er steht in der Nähe zur Arte Povera, in deren Arbeiten sich die Dinge selbst zeigen: unvermittelt, unglatt, unvergügbar. Stehles Materialien – Wachsstift, Tape, Acryl – folgen keiner akademischen Hierarchie. Alles kann Treiber des Impulses sein. Und letztlich ist er eine Nachfahrt der amerikanischen Abstraktion – aber ohne desren Pathos. Wo bei Rothko das Transzendente aufladen ist, kann bei Stehle der Zustand offen sein. Wo bei Newman das Sublime droht, bleibt bei Stehle das Schweigen wach. Bildliche Erregungsfelder. War bei Twombly noch eine Denkspur ist,wird bei Stehle zu einem Spur des Nicht-Denks. In den vorliegenden Wer-ken Gregor Stehles manifestieren sich alle diese Prinzipien: Ein würdiger Dunkler Farbkörper auf Weiß – wie ein Windstuß auf einer Flamme, aus dem sich ein Vortex bildet. Nichts ist umrissen. Alles ist Präsenz. Die Farbe ist nicht Farbe, sagen wir zustand. Eine Flamme, auf der sich verlieren Farbset-zungen vertilen – Rot, Blau, Gelb, Grün, Schwarz – wie Zeichen eines Systems, das keine Sprache hat. Die Felder stehen einzeln, aber sie ru-fen einander. Sie wollen nichts – sie sind. Und gerade dadurch sprechen sie. Eine Kreidezeichnung, zerfasert, zerkratzt, auf einer beigen Flamme – wie der Abzug eines Denks, das sich nicht artikuliert, sondern spürt. Nichts ist Abgeschlossen. Alles ist Möglichkeit. Sie sind. Und sie fordern. Nicht weil sie laut sind,sondern Weil sie sich begeistern.
Seine Bilder sind kein letzter Schrei, sagen ein erster Atemzug. Raum, der denkt. Gregor Stehle erlaubt dem Raum, Raum zu sein. Das klingende Licht, ist aber eine grundlegende Provokation in einer Kunstwelt, die auf Bedeutung, Deutung, Halt ausgericht ist. Stehle stellt keine Fragen. Er stellt Zusände sie. Seine Kunst ist nicht Aussage, wohl Haltung. Kein Objekt, sondern Prozess. In einer Zeit, in der Bilder schrill und Bedeutungsschwer sein müssen, bietet seine Arbeit eine radikale Gegen-Position: Sie ist leer – aber volle Spannung. Trotzdem – aber voller Kraft. Reduziert – aber voller Welt. Viellicht ist genau das der entscheidende Punkt:
Dass Gregor Stehles Malerei nicht erklären wird, sondern erleben lässt. Nicht repräsentiert, sondern resoniert. Nicht besetzt, sicher befreit.
Und viel Licht beginnt genau dort die Zukunft der Malerei.
Raum ist Beziehung. Und Beziehung ist die eigene Substanz der Welt.
( Quelle: Text: Carsten Lehmann 2024, München)
Lesen Sie weiter:
abstrakte zeitgenössische Malerei von Gregor Stehle